Videos
(auch verfügbar auf Englisch und Französisch, Sprache wählen oben rechts)
1/12 Einführung | Werkzeuge und Methoden zur Unterstützung von Ko-Kreationsprozessen
Innovation entsteht selten im Alleingang, sondern meist durch einen kollektiven Prozess, an dem mehrere Akteure beteiligt sind. Doch wie können solche kollektiven Innovationsprozesse gezielt unterstützt und erfolgreich begleitet werden? Wie lässt sich die Kreativität einer Gruppe fördern, um gemeinsam neues Terrain zu erkunden und marktfähige Lösungen zu entwickeln?
Diese Videoserie gibt einen Überblick über zentrale Methoden, die interaktive Innovations- und Ko-Kreationsprozesse unterstützen. Dabei spielen das spezifische Problem, der Kontext und die zu beantwortenden Fragen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der passenden Methode.
Zu den vorgestellten Ansätzen gehören:
- Das Cynefin-Modell, um das zum Problemkontext passende Vorgehen zu wählen. https://youtu.be/6xb7AiRCl7w
- Das Double-Diamond-Modell als strukturiertes Vorgehen, um dem Problem- und dem Lösungsraum die notwendige Aufmerksamkeit zu geben. https://youtu.be/5FFixLcK0kw
- Die Initiativspirale, um den Verlauf einer Initiative zu betrachten. https://youtu.be/2l_5fMSflUY
- Der warme und kalte zur optimalen Unterstützung der Zusammenarbeit. https://youtu.be/2NApsyJcd0U
- Der Kohärenz-Kreis zur Analyse von Interaktionen in einem Netzwerk. https://youtu.be/44t9U3oZaPQ
- Das Co-Kreations-Dreieck zur Klärung der Rollen und Positionen der beteiligten Akteure. https://youtu.be/4q0bSo2wgjs
- Die Netzwerkanalyse, um relevante Akteure ins Projekt einzubinden. https://youtu.be/hnWN5rZBvZc
Die Unterstützung von interaktiver Innovation erfordert jedoch mehr als die Wahl der geeigneten Methode. Entscheidend ist auch eine Haltung, die Co-Kreation fördert und vertrauensvolle Beziehungen sowie gemeinsames Lernen unterstützt.
Diese Videoserie wurde im Rahmen des EU-Projekts i2connect entwickelt. Die vorliegenden Videos sind eine von der AGRIDEA und dem FiBL weiterentwickelte und in die Sprachen Deutsch und Französisch übersetzte Version der Videos.
2/12 Die Netzwerkanalyse | Fehlende Verbindungen identifizieren
Die Netzwerkanalyse wurde speziell für die Begleitung von innovativen Netzwerken entwickelt. Sie ist ein wertvolles Werkzeug, um die Akteure in einem Netzwerk sichtbar zu machen. Sie hilft bereits bestehende Verbindungen zu identifizieren und zu erkennen, welche Verbindungen fehlen, um die Initiative erfolgreich voranzubringen.
Die Netzwerkanalyse ist insbesondere zu Beginn eines Projekts wertvoll, da sie hilft, zentrale Personen für den Erfolg der Initiative zu identifizieren. Das Werkzeug kann jedoch auch im weiteren Verlauf genutzt werden, um zu prüfen, wer noch eingebunden werden sollte. Die Analyse liefert wertvolle Erkenntnisse über die nächsten Schritte, die notwendig sind, um die Initiative erfolgreich voranzubringen.
3/12 Das Ko-Kreations-Dreieck | Rollen und Positionen der Akteure in deinem Projekt besser verstehen
Das Ko-Kreations-Dreieck verdeutlicht, welche Rollen und Positionen die Akteure in einem innovativen Netzwerk innehaben. Für erfolgreiche Co-Kreation ist es essenziell, dass die Akteure in komplementären Positionen agieren und sich gegenseitig ergänzen.
Die drei Ecken des Dreiecks stehen für drei unterschiedliche Rollen:
- Der Initiator/die Initiatorin: Die Person, die die Idee ins Leben ruft.
- Der Manager/die Managerin: Verantwortlich für die Koordination und Steuerung des Projekts.
- Die Anbieter:innen: Personen oder Gruppen, die Ressourcen, Know-how oder Unterstützung bereitstellen.
Das Modell bietet eine wertvolle Orientierung, um zu erkennen, welche Akteure in welchen Rollen agieren und wo möglicherweise Lücken bestehen. Wenn beispielsweise zwar jemand in der Position des Managers oder der Managerin ist, diese Rolle jedoch nicht aktiv ausfüllt, könnte es wichtig sein, Massnahmen zur Schliessung dieser Lücke zu ergreifen.
Eine besondere Rolle ist die des freien Akteurs. Die Person, die diese Rolle besetzt,kann vermitteln, wenn es Schwierigkeiten gibt. Entscheiden ist allerdings, dass die Person von allen Akteuren im Netzwerk akzeptiert ist und diese eine solche Vermittlung auch wünschen.
4/12 Die Timeline-Methode | Gruppenprozesse reflektieren
Die Timeline-Methode ist ein einfaches und effektives Werkzeug, um Gruppenprozesse in innovativen Projekten zu reflektieren. Dabei werden drei Ebenen betrachtet:
- Positive erlebte Momente: Höhepunkte und Erfolge
- Negative erlebte Momente: Herausforderungen und Schwierigkeiten
- Erkenntnisse: Wichtige Lektionen und Einsichten
Entlang einer Zeitlinie, die zentrale Phasen im Projekt enthält, halten die Teilnehmenden positiv und negativ erlebte Momente sowie Erkenntnisse auf Post-ist fest, um so für das Projekt zentrale Ereignisse zu visualisieren.
Die Methode hilft, die Dynamik innerhalb der Gruppe besser zu verstehen und Momente mit viel und mit wenig Energie zu erkennen, um daraus wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Sie kann flexibel genutzt werden – von der Analyse einzelner Workshops bis hin zur Reflexion langfristiger Projekte. Zudem dient sie als ideale Grundlage für die Erstellung von Lerngeschichten oder Berichten.
5/12 Der Kohärenzkreis | Interaktionen in Netzwerken besser verstehen
Der Kohärenzkreis ist ein Modell, das dabei hilft, Interaktionen in innovativen Netzwerken besser zu verstehen. Im Mittelpunkt steht der vitale Raum, ein Zustand, in dem die Zusammenarbeit reibungslos und effektiv verläuft.
Das Modell besteht aus vier Quadranten, die genutzt werden, um die Bedürfnisse hinter defensivem Verhalten von Projektpartnern zu erkennen. Zum Beispiel kann Desinteresse auf einen Mangel an Inspiration hindeuten, während Widerstand ein unerfülltes Bedürfnis nach Anerkennung offenbaren kann.
Wenn die Qualität der Interaktionen abnimmt, unterstützt der Kohärenzkreis die Analyse und gibt Hinweise auf mögliche Interventionen, um zu einer positiven Dynamik beizutragen und die Zusammenarbeit im Projekt zu stärken.
6/12 Die Initiativen-Spirale | Zur Entwicklungsphase eines innovativen Projekts passende Aktionen erkennen
Die Initiativen-Spirale ist ein effektives Werkzeug, um den Entwicklungsprozess eines innovativen Projekts zu betrachten. Jede Phase erfordert verschiedenartige Aktionen, an denen immer wieder auch andere Akteure beteiligt sind.
Auch die Rolle von Beratungspersonen ändert sich im Laufe des Prozesses:
- So liegt der Fokus in der Inspirationsphase mehr auf der Förderung von informellen Netzwerken, um Ideen und Inspiration zu sammeln.
- In der Planungsphase tritt die Unterstützung beim Aufbau formeller Netzwerke mehr in den Vordergrund, um förderliche Strukturen zu etablieren.
- In der Verbreitungs- und Verankerungsphase geht es wiederum verstärkt um die Begleitung von Kommunikation und Verbreitung, um eine nachhaltige Verankerung zu unterstützen.
Das Modell berücksichtigt zudem die Dynamik von warmen und kalten Prozessen. Warme Prozesse sind besonders wichtig in der Anfangsphase (Idee und Inspiration) sowie in der Verbreitungsphase, um Motivation und Begeisterung zu fördern.
Die Initiativen-Spirale hilft den Fokus darauf zu lenken, welche spezifischen Massnahmen in der jeweiligen Entwicklungsphase einer Initiative entscheidend sind.
7/12 Der Kopfstand und andere Methoden, um die Kreativität einer Gruppe zu entfalten
Die Kopfstand-Methode ist eine Technik, die darauf abzielt, Kreativität in innovativen Projekten zu fördern. Sie basiert auf dem Prinzip des Perspektivenwechsels und ermutigt dazu, Probleme oder Fragestellungen aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten. Die ursprüngliche Frage wird dabei einfach umgedreht, sprich ins Negative gewendet. So sammeln wir zum Beispiel Antworten auf die Frage, was wir tun müssen, um ein Projekt möglichst in den Sand zu setzen und übersetzen die gesammelten Ideen dann wieder in positive Antworten auf die anfängliche Frage, wie wir zum Gelingen des Projekts beitragen können.
Kreativität kann aber auch durch andere Ansätze angeregt werden, wie zum Beispiel:
- Inspiration durch ähnliche Situationen.
- Nutzen visueller Assoziationen, um neue Ideen zu entwickeln.
Kurz gesagt: Alles, was gewohnte Denkmuster aufbricht, trägt dazu bei, die Kreativität zu fördern und innovative Lösungen zu finden.
8/12 Doppel-Diamant-Modell | Ein gemeinsames Problemverständnis entwickeln – als Basis für effektive Lösungen
Wenn wir mit einem Problem oder einer Herausforderung konfrontiert sind, besteht häufig die Versuchung, schnell nach Lösungen zu suchen, ohne sich ausreichend mit dem Problem befasst zu haben. Der doppelte Diamant unterstützt ein strukturiertes Vorgehen, das hilft sowohl dem Problem- als auch dem Lösungsraum die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.
- Im Problemraum stehen die verschiedenen Sichtweisen auf das Problem im Vordergrund. Das Team erarbeitet ein gemeinsames Verständnis der Herausforderung und einigt sich auf ein gemeinsames Ziel.
- Im Lösungsraum werden verschiedene Lösungsansätze erkundet, bewertet und getestet. Am Ende einigt sich das Team auf die beste Option.
Das Vorgehen fördert das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit und unterstützt kreative Lösungen sowie fundierte Entscheidungen im Projekt.
9/12 Peer-Coaching | Die Erfahrungen von Kolleg:innen nutzen
Hin und wieder kann es in einem innovativen Projekt sinnvoll sein, einen Zwischenstopp einzulegen, um anstehende Fragen oder Herausforderungen zu betrachten und die Perspektive sowie Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen miteinzubeziehen.
Das Peer-Coaching ist ein strukturierter Prozess, der genau dies unterstützt. Der Ansatz hilft, neue Impulse, Ideen und wertvolle Erkenntnisse für die eigene Arbeit im Projekt zu gewinnen. Es fördert den Austausch und stärkt die Zusammenarbeit im Team.
10/12 Mindset | Die richtige Haltung als Voraussetzung für erfolgreiche Co-Kreationsprozesse und interaktive Innovation
Die Förderung von Co-Kreation und interaktiver Innovation setzt eine Haltung voraus, die folgende Aspekte beinhaltet:
- Mit dem "Nicht-Wissen" arbeiten.
- Vertrauen in die Kreativität der Gruppe haben.
- Aus Fehlern lernen.
- Den Mut zum Experimentieren zeigen.
- Empathie und Neugierde praktizieren.
- Einen vertrauensvollen Rahmen für die Zusammenarbeit schaffen.
Diese Elemente sind wichtig, um Co-Kreationsprozesse zu gestalten und interaktive Innovation zu unterstützen.
11/12 Warmer und kalter Prozess | Mit Soft Skills und Projektmanagement-Fähigkeiten zum Erfolg
Bei der Entwicklung eines innovativen Projekts ist es essenziell, sowohl den kalten als auch den warmen Prozess zu berücksichtigen:
- Der kalte Prozess umfasst klassisches Projektmanagement, wie die Definition von Zielen, die Planung von Ressourcen und die Schaffung klarer Strukturen.
- Der warme Prozess richtet den Fokus auf die Menschen, ihre Ideen und die Energie, die in der Zusammenarbeit entsteht.
Es geht dabei nicht nur um die Anwendung bestimmter Methoden, sondern auch um die Pflege von Beziehungen auf Augenhöhe und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Die Kombination aus warmem und kaltem Prozess ist entscheidend, um innovative Projekte erfolgreich umzusetzen.
12/12 Das Cynefin-Modell | Den Kontext verstehen, um Probleme effektiv zu lösen
Das von Dave Snowden entwickelte Cynefin-Framework hilft das zu einer spezifischen Problemkontext passende Vorgehen zu wählen und ist damit auch für Landwirtschaftsberater:innen ein wertvolles Werkzeug. Es unterscheidet einfache, komplizierte, komplexe und chaotische Kontexte.
- Einfache Kontexte: Bewährte Praktiken können angewendet werden, da die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung eindeutig ist.
- Komplizierte Kontexte: Erfordern Expertise oder Forschung, um passende Lösungen zu entwickeln.
- Komplexe Kontexte: Erfordern Vielfalt und iterative Ansätze, da Ursache-Wirkungs-Beziehungen nicht oder nur im Nachhinein erkennbar sind. Lösungen entstehen durch Ausprobieren und gemeinsames Lernen.
- Chaotische Kontexte: Erfordern entschiedenes Handeln, um Stabilität herzustellen, bevor weitere Schritte möglich sind.
Das Verständnis des jeweiligen Kontexts ist entscheidend, um den richtigen Ansatz zu wählen und Probleme effektiv zu lösen.


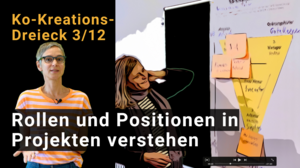
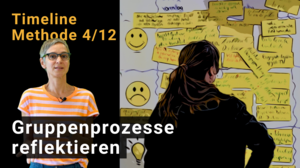
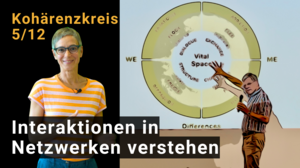
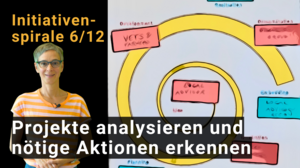

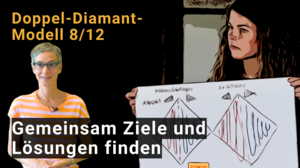
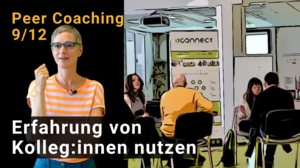
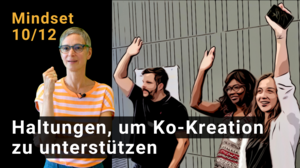

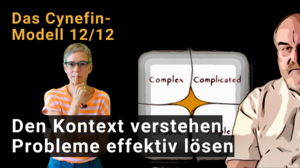
 tippen und dann zum Befehl zum Home-Bildschirm hinzufügen nach unten scrollen.
tippen und dann zum Befehl zum Home-Bildschirm hinzufügen nach unten scrollen.